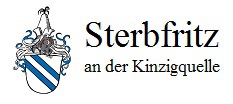Didaktisches Potential
Neben dem Gedenken an die Sterbfritzer und Sterbfritzerinnen, die in der Zeit des Nationalsozialismus gewaltsam zu Tode gekommen sind, ist es dem Chronik-Team ein zentrales Anliegen, dass das DENKmal! Sterbfritz als geschichtlicher Lernort von Schülergruppen und Konfirmanden, aber auch im Rahmen der Erwachsenenbildung genutzt werden kann. Damit erhält das DENKmal! neben dem in die Vergangenheit gerichteten Aspekt des Erinnerns eine in die Zukunft weisende Funktion als Lernort gegen den Krieg und für den Frieden, als Lernort gegen Antisemitismus und für Toleranz. Entsprechende Überlegungen spielten schon bei der Planung eine wichtige Rolle.
Aus unserer Sicht bietet das DENKmal! Anknüpfungspunkte nicht nur für den Geschichts-Unterricht, sondern auch für die Fächer Evangelische und Katholische Religion, Ethik sowie Politik und Wirtschaft.
Im Folgenden werden einige Überlegungen zum didaktischen Potential des Ensembles dargestellt, die Lehrkräften erste Anregungen zur Gestaltung ihres Unterrichts liefern sollen.
1 Annäherung: Erkundung / Entdeckendes Lernen
Das DENKmal! sollte von SchülerInnen oder KonfirmandInnen zunächst möglichst ohne größere Vorgaben durch die Lehrkraft erkundet werden. Eine solche erste Erkundung dürfte aufgrund der durch drei Plätze gegliederten Anlage des Ensembles und seiner Formensprache Fragen aufwerfen, die im Verlauf des Unterrichts aufgegriffen werden sollten oder auch zur Grundlage der inhaltlichen Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung durch die Lehrkraft werden können.
2 Lebensweltlicher und lokalgeschichtlicher Ansatz
Das DENKmal! wird Teil der Lebenswelt der SchülerInnen sein. Es ist vor Ort zugänglich und erlebbar. Durch den lokalgeschichtlichen Ansatz soll gezeigt werden, dass die Zeit des Nationalsozialismus nicht nur „große Geschichte“ ist, die in Berlin, London oder Moskau „gemacht“ wurde. Vielmehr ereignete sich diese Geschichte in jedem noch so kleinen und vermeintlich unbedeutenden Ort, hinterließ Spuren in nahezu allen Familien und forderte Opfer, deren Namen auf dem DENKmal! genannt werden.
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem DENKmal! können und sollen die Lernenden auch zu einer Spurensuche in der Geschichte ihrer eigenen Familie angeregt werden.
3 Fokussierung auf Einzelschicksale
Hinter jedem Namen auf dem DENKmal! steht das Schicksal eines Menschen mit seiner Lebens-Geschichte. Diese Biographien werden in der Internet-Chronik (www.sterbfritz-chronik.de) nach und nach bereitgestellt und können dort abgerufen werden (z.B. über QR-Codes). Durch die Beschäftigung mit Einzelschicksalen wird die „große Geschichte“ für SchülerInnen konkret und anschaulich nachvollziehbar und somit besser begreifbar und zugänglich als im Geschichtsbuch. Die Beschäftigung mit Geschichte erhält durch diese Fokussierung nicht zuletzt eine emotionale Dimension.
4 Chronologischer Aufbau
Dem DENKmal! liegt ein chronologischer Aufbau zu Grunde. Die Platzfolge folgt der Chronologie und markiert drei Abschnitte der deutschen Geschichte, zu denen geschichtliches Lernen möglich wird: Erster Weltkrieg – Zweiter Weltkrieg und Holocaust – der Umgang mit der Geschichte und die Geschichte des Gedenkens in Sterbfritz nach 1945.
Das Zentrum des Ensembles bilden die Stelen mit den Namen der gefallenen und vermissten Soldaten einerseits und den Namen der Sterbfritzer Holocaust-Opfer andererseits. Auch hier kommt das chronologische Prinzip zum Tragen und eröffnet Lernchancen. Im Hinblick auf den Unterricht wird besonders an dieser Stelle die Verzahnung von Lokalgeschichte und sogenannter großer Geschichte deutlich.
4.1 Gefallene und Vermisste
Die chronologisch angeordneten Stelen machen die Verteilung der Gefallenen und Vermissten auf die Kriegsjahre sichtbar. Diese Anordnung verdeutlicht den Charakter des Zweiten Weltkriegs als Vernichtungskrieg. Durch einen Vergleich mit den beiden Namenstafeln zum Ersten Weltkrieg kann dieser Charakter des Zweiten Weltkriegs noch eindrücklicher werden.
Durch die Fokussierung auf Einzelschicksale können Informationen zum Kriegsverlauf und Kriegsschauplätzen (z.B. Schlacht um Stalingrad) konkret mit dem Schicksal einzelner Soldaten verbunden werden.
4.2 Holocaust-Opfer
Dies gilt – mutatis mutandis – auch für die Opfer des Holocaust. Es geht darum, die Schicksale einzelner Menschen aus der anonymen und abstrakten Masse von 6 Millionen Opfer herauszuholen. Themen, die hier im Unterricht behandelt werden können, sind z.B.: Planung und Verlauf des Holocaust – Orte der Vernichtung – Methoden der Vernichtung (Erschießungen; Ermordung durch Giftgas).
5 Jüdisch-christliches Zusammenleben
Neben der Zeit des Zweiten Weltkriegs bildet die Erinnerung an das jüdisch-christliche Zusammenleben in Sterbfritz die zweite inhaltliche Säule des DENKmal! Das Zitat aus dem Buch Max Dessauers als Teil des Ensembles macht dies augenfällig:
„Wie es früher war, weiß niemand mehr. Christen und Juden lebten hier einmal brüderlich beieinander. Dann geriet Hitler an die Macht. Dann kam die Kristallnacht. Dann kamen die Judensterne. Dann, bald nach Kriegsbeginn, wurden die noch im Dorf lebenden Juden nach dem Osten deportiert. Die christlich-jüdische Lebensgemeinschaft, die an diesem Ort entstanden war und mehr als 300 Jahre Bestand hatte, wurde innerhalb weniger Jahre vollkommen zerstört. Heute ist in meinem Dorf niemand mehr, der in einer Synagoge betet.“
Mit den Büchern von Max Dessauer (Aus unbeschwerter Zeit. Frankfurt, 1962), Johann Georg Schwarz (Hanjürg der Letzte. Höchst i.Odw., 1970) und Israel Nussbaum (Gut Schabbes. Berlin, 2002) stehen Sterbfritzer lokalgeschichtliche Quellen zur Verfügung, die das einvernehmliche Zusammenleben von Christen und Juden am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts bezeugen. Henry Schusters Erinnerungen (Von Sterbfritz nach Las Vegas. Hanau, 2011) werfen ein Schlaglicht auf den Antisemitismus vor Ort und das Ende des jüdisch-christlichen Zusammenlebens in der NS-Zeit.
Die Bücher Dessauers, Nussbaums und Schusters sind Zeugnisse der unwiederbringlich zerstörten Lebenswelt der hessischen Landjuden und bieten damit auch einen Zugang zur Beschäftigung mit der jüdischen Religion, ihren Festen und Bräuchen.
6 Friedens-Erziehung
Mit dem Zitat aus einem Feldpostbrief von Heinrich Euler (Anfang 1943 vermisst in Stalingrad) erhält ein dezidiert pazifistisches Bekenntnis einen zentralen Ort im DENKmal!:
„Nun, liebe Eltern, habe ich den Krieg auch in seinen schrecklichsten Formen kennengelernt und ich muss Euch nun recht geben, denn Ihr wart ja gegen den Krieg, und ich bekenne mich nun heute auch zu den größten Gegnern des Krieges.“
„Nie wieder Krieg!“ – Diese Forderung wurde geprägt von Menschen, die den Ersten Weltkrieg erlebt und überlebt hatten. Wie kann dieser Slogan lebendig und begreifbar werden, so dass er mehr ist als nur eine hohle Phrase, die an Gedenktagen immer wieder zitiert wird, aber keine Konsequenzen hat?
Angesichts aktueller bewaffneter Konflikte in Europa und der Welt stellen sich Fragen wie: Wie verhalten wir uns heute gegenüber dem Krieg? Ist der Krieg nicht schon (wieder) Teil der Normalität geworden? Haben wir uns an ihn gewöhnt? Kann Pazifismus eine realistische Position sein (Gesinnungsethik vs. Verantwortungsethik)?
7 Wie Menschen mit Menschen umgehen – Ethische und politische Bildung
In Anknüpfung an die historische Thematik der Ausgrenzung, Entrechtung, Vertreibung und Ermordung der Juden bietet sich die unterrichtliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten der ethischen und politischen Bildung an. Schlagwortartig seien dazu genannt:
- Historischer und (immer wieder) aktueller Antisemitismus
- Umgang und Zusammenleben mit religiösen bzw. gesellschaftlichen Minderheiten
- Die Menschenrechte und ihre universelle Geltung – Quellen des Begriffs der Menschenwürde (z.B. biblische
Schöpfungsgeschichte; Aufklärung etc.)
- Kommunikation und menschliches Miteinander: Begünstigung, Entstehung und Entwicklung von Neid, Missgunst, Hass und Hetze
Im Kern geht es bei diesen ethischen und politischen Themen immer um die Frage: Wie gehen wir mit dem Anderen, mit dem Anders-Sein um?
Die Juden in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren in ihrer Mehrheit assimiliert, wollten nicht anders sein bzw. haben versucht, ihr Anders-Sein so wenig wie möglich in den Vordergrund zu stellen: die Zahl der Mischehen stieg; die Zahl der Christen jüdischer Herkunft war etwa so groß wie die Zahl der in Deutschland lebenden Juden (ca. 500 000); viele Juden versuchten, in ihrem Patriotismus ihre nicht-jüdischen Landsleute zu übertreffen (Einsatz der deutschen Juden im Ersten Weltkrieg).
In den Augen der nationalsozialistischen Ideologie waren diese Bemühungen um Anpassung bzw. Assimilation keinen Pfifferling wert. Der Jude blieb Jude und konnte kein „Deutscher“ im nationalsozialistischen Sinn werden, weil er anders war. Für die NS-Ideologie machte sich dieses Anders-Sein an dem Kriterium der Rasse bzw. des Blutes fest.
Die Kriterien, wer zu einer Gemeinschaft gehört und wer nicht, weil er anders ist, sind letztlich austauschbar und können mehr oder weniger willkürlich gesetzt werden: Herkunft, Hautfarbe, Religion, Sprache, sexuelle Orientierung – Haarfarbe, Augenfarbe, Brillenträger, Alter, Gesundheit.
Daher ist es ein zentrales Ziel schulischer Bildungsarbeit, die universelle Geltung der Menschenrechte und der Idee der Menschenwürde als deren Basis zu vermitteln. Menschenrechte und Unantastbarkeit der Menschenwürde sind nicht selbstverständlich. Jeder Einzelne muss sich immer wieder neu dafür einsetzen.
8 Problematisierung der Begriffe „Täter“ und „Opfer“
Unter den am DENKmal! genannten gefallenen und vermissten Soldaten befinden sich auch überzeugte Nationalsozialisten (z.B. der damalige Sterbfritzer Bürgermeister Wilhelm Müller). Dies kann ein Ansatzpunkt sein für eine Problematisierung der Begriffe „Täter“ und „Opfer“. Hier können auch die Schwierigkeiten von Erinnerungsarbeit vor Ort deutlich gemacht werden.
9 Der schwierige Umgang mit der deutschen Geschichte -
Erinnerungskultur im Wandel
Das Gedenken an die Opfer des Holocaust beschränkt sich in Sterbfritz zurzeit auf eine unscheinbare, vor der Kirche liegende Gedenktafel, die im Frühjahr 2004 auf Betreiben eines ehemaligen Sterbfritzer Juden eingeweiht wurde. Diese Tafel und ihre Geschichte ist Ausdruck der damaligen örtlichen Erinnerungskultur: Man wollte nicht allzu deutlich an die auch in Sterbfritz an Juden verübten Gewalttaten erinnern und an die Ermordung eines Drittels der jüdischen Gemeinde im Holocaust – und versuchte daher, das Erinnern auf ein Minimum zu beschränken. Dies bedeutete vor allem, dass die Namen der Ermordeten nicht auf der Gedenktafel in Sterbfritz genannt, sondern gleichsam ausgelagert wurden auf den Jüdischen Friedhof in Altengronau. Dort wurde nach der Einweihung der Gedenktafel in Sterbfritz am selben Tag im Jahr 2004 eine solche Namenstafel eingeweiht. Es entstand damit etwas, was ein damaliger Besucher der Veranstaltungen als die Sterbfritzer „Topographie des Gedenkens“ bezeichnete.
Auch das namentliche Gedenken der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten war bislang in Sterbfritz nicht möglich. Mehrere Anläufe wurden dazu seit den 1960er Jahren unternommen, die alle im Sande verliefen. Im Jahr 2000 wurde schließlich eine allgemein gehaltene und mit einem Eisernen Kreuz (!) versehene Tafel mit der Aufschrift „Unseren Gefallenen und Vermissten des Krieges 1939 – 1945 zum Gedenken“ am Mahnmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs angebracht.
Der neu gestaltete Kirchenvorplatz als Ort des Erinnerns wird mit dem DENKmal! auch die Geschichte des Gedenkens in Sterbfritz sichtbar machen. Der Wandel der Erinnerungskultur wird vor Ort exemplarisch nachzuvollziehen sein.
10 Schüler-Forschungs-Projekte / Forschendes Lernen
Nicht alle Einzelschicksale sowohl auf Seiten der Gefallenen wie auch bei den Opfern des Holocaust sind gleichermaßen gut erforscht. Hier bietet sich die Möglichkeit zu Recherche-Projekten von Schülern und Schülerinnen.
Thomas Müller, 12.07.2025